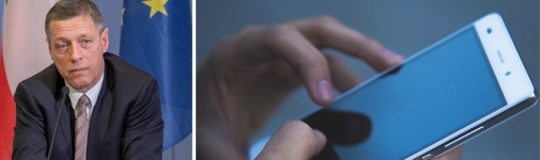De Gaulle mochte den Élysée-Palast nicht. Er hätte als Präsident das Pantheon als Amtssitz bevorzugt und bezeichnete den Palast des französischen Staatspräsidenten neben den Champs-Élysées als Puderdose. Dies ist einer der seltenen Fälle, wo das Wienerische einem französischen Aperçu noch einen zusätzlichen Kick verleiht.
Die durchaus üppige Ausstattung geht auf Madame de Pompadour zurück, und der Gedanke, sein Ambiente einer Mätresse zu verdanken, ließ den ersten Präsidenten der Republik nach dem Zweiten Weltkrieg offenbar nicht kalt. Dabei sollte man festhalten, dass die Pompadour, anders als die du Barry, die mit ihr oft in einem Satz genannt wird, eine kultivierte und bedeutende Person war, die u.a. auch den Bau der Militärakademie veranlasste.
Wer dort wohnt, 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré, bekleidet das mächtigste Amt eines Staatsoberhaupts in der westlichen Welt, mächtiger noch als das des Amtskollegen im Weißen Haus. Kein Wunder, dass der Name des jeweils aktuellen französischen Ministerpräsidenten nicht jedem geläufig ist. Entschieden wird im Élysée.
Dort herrscht strengste Etikette, gegen die das spanische Hofzeremoniell wie unverbindliche Ratschläge eines Hippie-Zusammentreffens wirkt. Selbst Elizabeth II., die nun wahrlich keine größeren Schwierigkeiten hat, das richtige Besteck bei einem zwanziggängigen Dîner einzusetzen, gestand einmal, sich mit den Formalismen im Élysée schwer zu tun. Außerdem wird an dieser Adresse Weltpolitik gemacht.
Ein Schicksalstag
Am 23. April und höchstwahrscheinlich am 7. Mai 2017 werden die Franzosen darüber entscheiden, wer die nächsten fünf Jahre dort residiert und die Geschicke des Landes leiten wird. Sollte im ersten Wahlgang Ende April keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen – wie bei jeder Präsidentschaftswahl seit 1965 – kommt es am 7. Mai zur Stichwahl.
Manche Beobachter fühlen sich an 2002 erinnert. Damals war es der französischen Linken gelungen, den Wählern ein so attraktives Angebot zu machen, dass ihr Kandidat nicht einmal die Stichwahl erreichte. Obwohl Chirac bereits in einem Sumpf aus Korruption unterzugehen begann, haben ihn damals mehr als 82 % der Franzosen gewählt – mit zugehaltener Nase, wie man sagte. Sein Gegenkandidat war Jean-Marie le Pen, und einen deklarierten Rechtsextremen wollte zu Beginn dieses Jahrhunderts nur eine deutliche Minderheit an die Spitze des Staates hieven.
Le Pen again
Wenn die Auguren nicht völlig daneben liegen, wird die Stichwahl wieder gegen le Pen stattfinden, nur diesmal gegen Marine, die Tochter, Chefin des Front National. Noch vor wenigen Jahren wäre es der großen Mehrheit der Franzosen undenkbar erschienen, dass sie Frankreichs erste Frau im Präsidentenamt werden könnte. Es erscheint immer noch beinahe unvorstellbar.
Marine le Pen gibt sich deutlich konzilianter als ihr Vater, der schon einmal Ebola als Heilmittel gegen die Überbevölkerung in Afrika pries und gerne darauf hinwies, im Algerien-Krieg auch persönlich gefoltert zu haben. In der Sache ist sie ihm kaum fern. Der größte Unterschied ist, dass der Vater die EU von innen verändern wollte, Marine will sie beenden, Frankreich aus ihr entführen.
Dass seine eigene Tochter ihn aus der Partei, die er 39 Jahre lang angeführt hatte, ausgeschlossen hatte, war Jean-Marie le Pen die Bezeichnung „stalinistische Vorgangsweise“ wert, was für Liebhaber politischer Feinheiten durchaus bemerkenswert war.
Marine le Pens Chancen stehen an sich nicht gut. Die Franzosen haben in den letzten Jahrzehnten in schöner Regelmäßigkeit konservative Präsidenten aus dem Mitte-Rechts-Lager gewählt (und als Gegengewicht dazu ihre Gewerkschaften gestärkt). Die Jahre Francois Mitterrands waren die eine große Ausnahme, die des noch amtierenden Präsidenten Hollande eher die kleine, zu verdanken der Selbstverliebtheit seines Vorgängers Nicolas Sarkozy, der im Lande als „Monsieur Bling-Bling“ bezeichnet wird, was als „Herr Neureich“ unzureichend übersetzt werden kann.
Hollandes fulminante „Erfolge“, das Land aus der wirtschaftlichen Stagnation zu führen und sein Privatleben außen vor zu belassen, haben gemeinsam mit seinem selbst für Anhänger schwer zu erkennenden Charisma dafür gesorgt, dass ein weiterer Exponent der Sozialdemokraten wohl für einige Zeit chancenlos ist.
Les jeux sont faits – oder?
Damit sollte der Weg frei sein für einen Kandidaten der bürgerlichen Sammelbewegung, die sich nun bereits mehrmals umbenannt hat, um weniger an die nicht nur gloriosen Verbindungen zu Chirac und Sarkozy zu erinnern. Nur hat bei den Republikanern, wie sie sich derzeit nennen, ein Selbstzerstörungsprozess seinen Lauf zu nehmen begonnen, der an Shakespeare‘sche Dramen erinnert.
Wer die französische Innenpolitik aufmerksam verfolgt, kommt in puncto Unterhaltungswert durchaus auf seine Kosten. Nach der großen, rätselhaften Sphinx Mitterrand, von dem man selbst die Existenz einer bis dahin völlig unbekannten Tochter erst gegen Ende seines Lebens erfuhr (und immer noch Unzureichendes aus seinen Jahren vor dem und im Widerstand), wurde das gegebene Stück immer öfter zur Comédie. Dominique Strauss-Kahn war schon eine pikante Idee als Präsidentschafts-Kandidat, aber wie einander dann Ségolène Royal und Francois Hollande die Wählerstimmen gegenseitig abnahmen (noch als Ehepaar, was danach bald bereinigt wurde), das hatte schon etwas. Man hatte diese Art lemmingmäßigen Verhaltens für eine besondere Begabung der Linken gehalten. Die Rechte beweist nun, dass sie das auch kann.
Nicolas Sarkozy hatte bis zuletzt an seine Chancen geglaubt, auch wenn sich die Hinweise immer noch mehr verdichten, dass seine geschlagenen Wahlkämpfe illegalerweise aus den Kassen des L’Oréal-Konzerns und peinlicherweise auch von Muammar Gaddafi millionenschwere Unterstützung erfahren haben. Fassungslos musste er mitansehen, in den Vorwahlen abgeschlagen auf Platz drei zu landen. Ihm bleibt Carla Bruni, neben einer sehr großzügigen Apanage des Staates auf Lebenszeit – in einer Dimension, die sich österreichische Kritiker am politischen System nicht einmal vorstellen können, ohne zu glühenden Verehrern der Jakobiner zu werden.
Der gemäßigte Alain Juppé wurde zum Erstaunen Vieler nur Zweiter, deutlich geschlagen von Francois Fillon, einem Mann, der durchaus als exponiert neoliberal und politisch deutlich rechts stehend bezeichnet werden kann. Er hätte vielleicht so manche potenzielle Wähler Marine le Pens angesprochen.
Rache, heiß serviert
„Hätte“, kann man an sich bereits sagen, weil Fillon nach allen Regeln der Kunst demontiert und von Heckenschützen abgeschossen wurde, wohl von Auftragsmördern aus dem eigenen Umfeld. Dass in einem Land, in dem das Budget des Präsidenten ein deklariertes und anerkanntes Staatsgeheimnis ist, jemand wie Fillon darüber stolpern könnte, seine Familie an seinen (und denen seines Amtsapparats) Einkünften teilhaben gelassen zu haben, ist von einer gewissen Pikanterie. Das wirkt im Ausland befremdlich, in der Grande Nation, die schon sehr viel größere Exzesse über sich ergehen hat lassen, wirkt das eher wie ein milder Treppenwitz. In einer von Terrorismus, signifikanter Arbeitslosigkeit und ansatzweiser Panik gebeutelten Nation, die nun sogar wirklich republikanisch sensibilisiert ist, kann das Fillon seine Chancen kosten.
Hinter vorgehaltener Hand ist vielen Beobachtern klar, wessen Rache da zuschlägt, und Sarkozy war noch nie ein guter Verlierer. Alain Juppé wird davon nicht profitieren. In einer Rede, die als apokalyptisch bezeichnet werden kann, hat er seine Kandidatur beendet: „Es ist zu spät“, waren seine bedeutungsschweren letzten Worte.
Nachdem die diversen Kandidaten der Kommunisten, der Sozialisten, der Zentristen und der Grünen es zum wiederholten Mal bewerkstelligt haben, sich auf keinen gemeinsamen Proponenten zu einigen, ist von dort kein Favorit für die Stichwahl zu erkennen, jedenfalls nicht mit freiem Auge.
There’s a new man in town
Damit betritt Emmanuel Macron die Bühne. „Zu schön, zu jung, zu intelligent“, das legendäre Grasser‘sche Diktum gilt für Macron absolut ebenso, nur ohne „zu“. Vor allem ist Macron ein sehr typischer Vertreter jener Elite, die in Frankreich die Politik macht: nach einem großen Lycée an einer noch größeren Uni („Sciences-Po“) über Macchiavelli und Hegel abgeschlossen zu haben war keine schlechte Voraussetzung ein echter Énarque zu werden, ein Absolvent der École nationale d’administration, die seit Generationen die Führungsschicht des Landes hervorbringt. Spitzenbeamter, Investmentbanker, Berater und Zögling Hollandes, Wirtschaftsminister waren die weiteren Stationen eines Mannes, der nichts als Erfolge kannte. Minister zu werden ohne Parteimitglied zu sein hat Macron Bewunderung und Feindschaften – und Neid – eingetragen. Nun folgt seine Stunde der Bewährung.
Für viele Franzosen, die einen erklärten Wirtschaftsliberalen ohne radikale Begleiterscheinungen gerne an der Spitze des Staates sehen wollen, ist Macron nun der Hoffnungsträger. Ob er sich durchsetzen kann, wird sich weisen.
Die Franzosen lieben das Pikante. Bisher hat ein unorthodoxes Privatleben noch kaum einem Spitzenpolitiker geschadet, und davon gab es weiß Gott genug in einem Land, das von nicht wenigen Kennern als das promiskuitivste Europas eingeschätzt wird – aber eben auch als das diesbezüglich Toleranteste.
Emmanuel Macron, dieser überaus gutaussehende junge Mann, geboren 1977, hat eine Frau, die seine Lehrerin gewesen war, sie ist 24 Jahre älter. Als in den letzten Wochen Gerüchte die Runde machten, Macron wäre homosexuell, war das das entscheidende Argument für Viele. Kann ja nicht sein, sieht so aus, ist so toll, und eine so viel ältere Frau…
Bald wurden Erklärungen nachgereicht, woher die Gerüchte stammten, und damit wird es heikel. Es scheint erwiesen, dass russische Quellen daran beteiligt waren, Macron zu desavouieren, wenn man als Desavouieren bezeichnen mag, dass ein potenzieller Staatenlenker möglicherweise so oder so orientiert ist.
Dass Marine le Pen allerbeste Kontakte zu Wladimir Putin hat, dass ihr Front National keine Kredite mehr in Frankreich erhält und aus Moskau schon, kann dabei eine Rolle spielen.
Europas bislang größte Prüfung
Worauf es ankommen wird, ist, ob la Douce France sich noch einmal seiner durchaus auch moralischen Verantwortung gewachsen erweist. Emmanuel Macron ist selbstverständlich ein typischer Vertreter der Elite, von der immer mehr Wähler nichts mehr erwarten. Der Trend zu populistischen Bewegungen kann ihn, der durchaus auch populistisch agiert, den Kürzeren ziehen lassen gegen eine, die dort schon viel länger erfolgreich ist.
Worum es auch geht, und eigentlich zuerst, ist, dass Marine le Pen die Europäische Union zerstören möchte. Neben all der Problematik des Fluches des Kolonialismus, für den Frankreich einen hohen Preis zahlt, muss sich erst zeigen, ob Frankreich den Verführungen eines postfaktischen Populismus widerstehen kann.
Es geht um Europa, um Nuklearpolitik im Energiesektor und bei Waffeneinsätzen, um die zweitgrößte Nation in der Union und um Europas Zukunft.
Im Élysée-Palast gibt es zwei Keller: den Atombunker mit dem Roten Knopf, und den bestsortierten Weinkeller der Erde. Nicht einmal die wüstesten Kommentatoren hätten bisherigen Bewohnern unterstellt, sich einmal in der Tür irren zu können. Marine le Pen könnte das nicht nötig haben. Die Sprengkraft ihres Handelns würde reichen.
 EU-Infothek.com
EU-Infothek.com